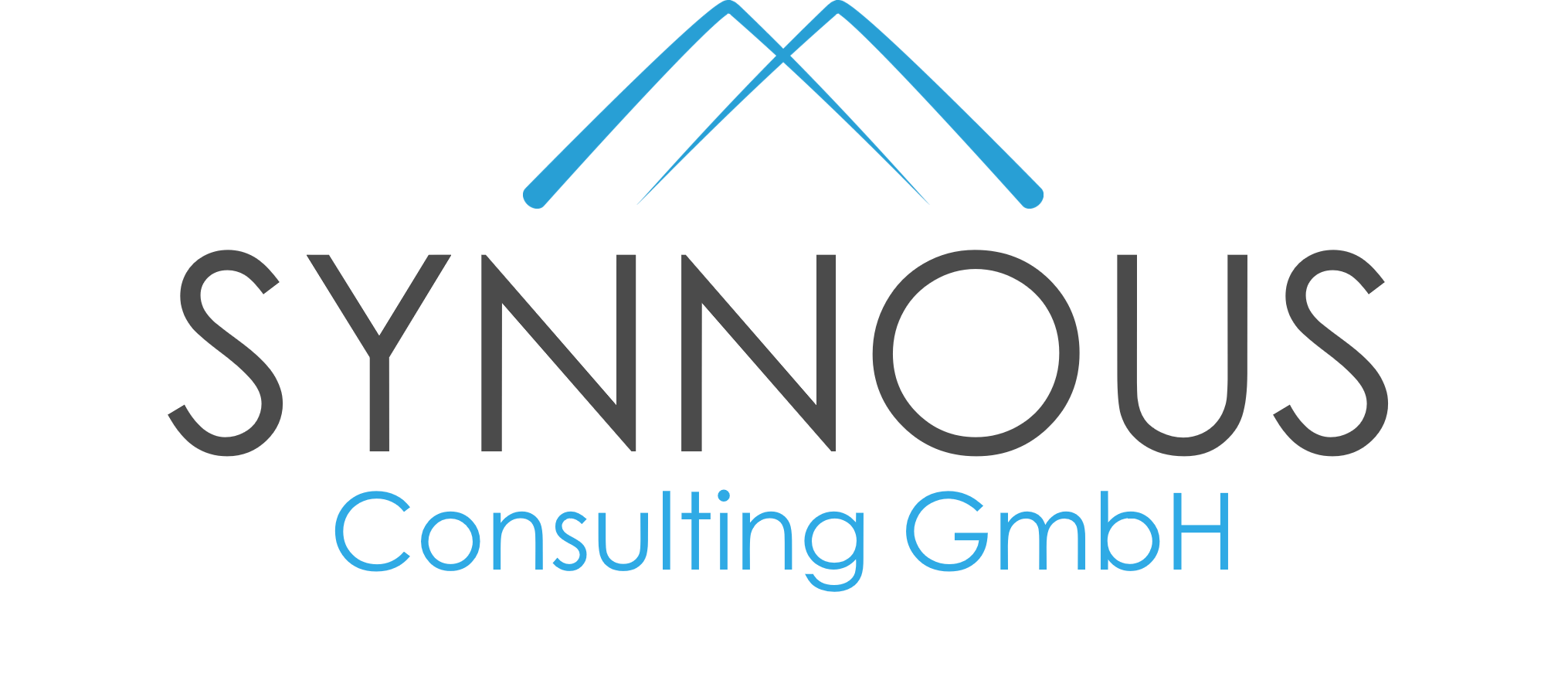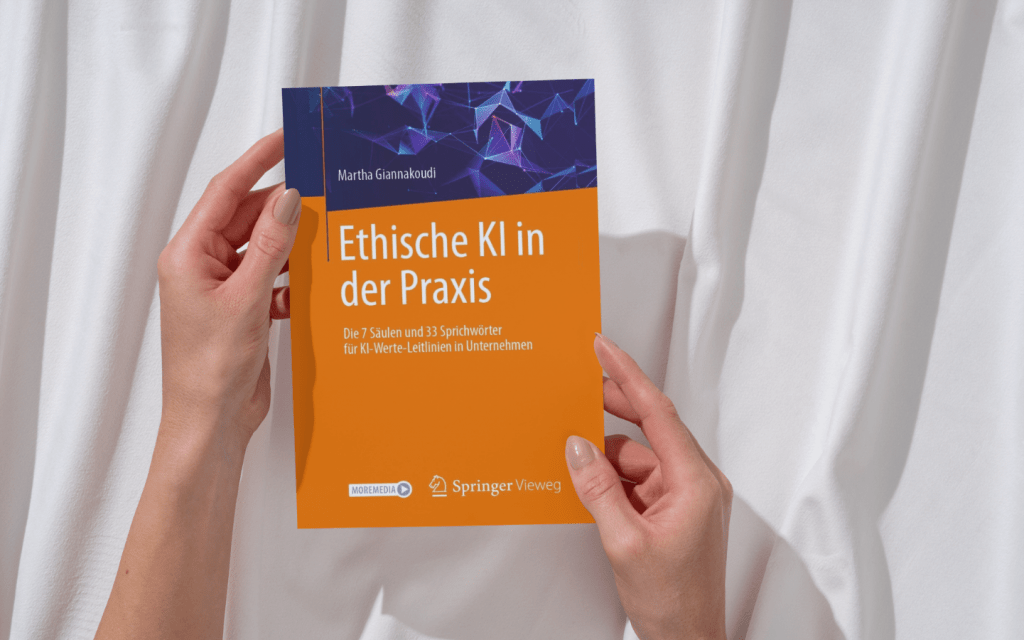Manchmal braucht es den Blick von außen, um zu erkennen, was im Inneren auf dem Spiel steht.
Professor Thomas Hollmann ist in Deutschland geboren und lebt seit mehr als drei Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten. Heute lehrt er als Marketingprofessor an der Arizona State University. Zuvor war er in führenden Positionen bei Mannesmann, Black & Decker und Xerox tätig. Diese Mischung aus wissenschaftlicher Schärfe und praktischer Erfahrung macht ihn zu einem außergewöhnlichen Beobachter unserer Zeit.
Für seine jüngste Untersuchung hat Holmann drei Monate in Deutschland verbracht und dabei rund fünfzig Organisationen besucht – von großen DAX-Konzernen bis zu kleinen Familienbetrieben. Sein Fazit ist ebenso klar wie unbequem: Deutschland droht, beim Thema Künstliche Intelligenz den Anschluss zu verlieren.
Doch der Grund dafür liegt weniger in fehlender Technologie als vielmehr in Haltung, Tempo und Unternehmenskultur.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Wenn das Auto zehn Jahre hinterherfährt
In Phoenix, wo Hollmann lebt, gehören fahrerlose Autos längst zum Stadtbild. Googles Tochterunternehmen Waymo betreibt dort einen riesigen, vollautonomen Taxiservice. Über eine Million bezahlte Fahrten finden pro Monat statt. Hollmann erzählt, dass er an einer Ampel stand und innerhalb weniger Minuten acht selbstfahrende Waymo-Fahrzeuge vorbeifahren sah.
Diese Realität wirkt wie aus einer anderen Welt, wenn man sie mit der Situation in Deutschland vergleicht. Hier wird gerade eine neue Teststrecke für autonomes Fahren eröffnet – Waymo hingegen testet seine Fahrzeuge seit 2015 auf den Straßen.
Für Hollmann ist das nicht nur ein technologischer Rückstand. Es ist ein Ausdruck unterschiedlicher Denk- und Entscheidungsgeschwindigkeiten. In den Vereinigten Staaten gehört Experimentieren zur Kultur. Fehler werden als notwendiger Teil des Fortschritts gesehen. In Deutschland dagegen wird oft noch geplant, kontrolliert und abgewogen, während andere längst handeln.
Sein Fazit fällt entsprechend nüchtern aus: „Ja dann, gute Nacht.”
Dieser Satz ist keine Kapitulation, sondern eine Warnung. Wenn wir die Geschwindigkeit der Entwicklung unterschätzen, verlieren wir nicht nur Zeit, sondern auch Zukunft.
Die USA stellen KI-Ingenieure ein, Deutschland Werkstudenten
Ein besonders deutliches Beispiel für die kulturellen Unterschiede findet Holmann auf dem Arbeitsmarkt. Er vergleicht Stellenausschreibungen auf Indeed: In den Vereinigten Staaten suchen Unternehmen nach AI Engineers mit Gehältern zwischen 150.000 und 350.000 Dollar im Jahr. In Deutschland erscheinen unter dem Stichwort „Künstliche Intelligenz“ dagegen vor allem Ausschreibungen für Werkstudentinnen und Werkstudenten.
Das ist mehr als ein statistischer Unterschied. Es zeigt, wie unterschiedlich Unternehmen über den Aufbau von Wissen denken. In den USA ist KI längst eine Kernkompetenz, in die gezielt investiert wird. In Deutschland ist sie häufig noch ein Experimentierfeld, das man erst einmal „ausprobiert“.
Hollmann fasst es prägnant zusammen:
„In den USA stellen sie AI Engineers ein. In Deutschland suchen wir einen Werkstudent und gucken mal was passiert.”
Hinter dieser Beobachtung steckt eine grundsätzliche Frage: Wie ernst meinen wir es mit der digitalen Transformation? Wer wirklich gestalten will, braucht Menschen mit Erfahrung, nicht nur Lernende. Wer Verantwortung übernehmen will, muss bereit sein, in Kompetenz zu investieren – nicht nur in Projekte.
Europa hinkt bei großen Sprachmodellen hinterher, aber das ist nicht das eigentliche Problem
Beim globalen Wettbewerb um die besten großen Sprachmodelle, die sogenannten Large Language Models, liegt Europa weit zurück. Hollmann beschreibt das mit einem anschaulichen Bild: Er vergleicht die Leistungsfähigkeit dieser Modelle mit einem IQ-Test. Während US-Modelle wie OpenAI oder Google bei etwa 117 Punkten liegen, also im oberen Bereich der menschlichen Intelligenz, erreicht das europäische Modell Mistral nur rund 74 Punkte. Das deutsche Modell Aleph Alpha liegt noch darunter.
Auf den ersten Blick klingt das ernüchternd. Doch Hollmann bleibt gelassen. Er hält diesen Rückstand für kaum aufzuholen, aber er sieht darin keine Katastrophe. „Es ist nicht so schlimm“, sagt er, und meint damit: Europa muss nicht die größten Modelle bauen, sondern sie am klügsten nutzen.
Die wahre Stärke könnte also darin liegen, Anwendungen zu entwickeln, die diese Technologie sinnvoll in den Alltag und in die Wirtschaft übersetzen. Genau hier liegt allerdings das nächste Problem. Wer Weltklasse in der Anwendung erreichen will, braucht ebenfalls Weltklasse-Expert*innen. Ohne sie bleibt jede Strategie Theorie.
Die gefährlichste Illusion: Zu glauben, man sei schon angekommen
In einem Punkt sind deutsche und amerikanische Unternehmen erstaunlich ähnlich. Beide nutzen zunehmend interne Tools wie Microsoft Copilot oder firmeneigene GPT-Lösungen. Auf den ersten Blick wirkt das fortschrittlich. Doch für Hollmann ist es eher ein Zeichen von Stillstand.
Viele Unternehmen betrachten die Einführung solcher Tools als Abschluss ihrer KI-Strategie. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt wird verkündet, man habe die digitale Transformation umgesetzt – und dann passiert oft jahrelang nichts mehr.
Diese trügerische Selbstzufriedenheit ist gefährlicher als Rückstand. Denn sie vermittelt das Gefühl, man habe bereits aufgeholt, während andere längst weitergehen. Hollmann beschreibt es so: „Es ist die Barriere im Kopf, die wir irgendwie überwinden müssen.“
Die eigentliche Barriere liegt also nicht in der Technologie, sondern in unseren Köpfen. Sie entsteht, wenn Unternehmen aufhören, Fragen zu stellen, und beginnen, sich mit dem Status quo zufrieden zu geben.
Das eigentliche Rennen läuft im Kopf
Hollmanns Beobachtungen zeichnen das Bild eines Landes, das technisch viel kann, aber kulturell zu zögerlich handelt. Die größte Herausforderung besteht nicht in fehlenden Ressourcen, sondern in einer Mentalität, die Sicherheit oft über Geschwindigkeit stellt und Perfektion über Lernen.
Deutschland hat zweifellos hervorragende Ingenieurinnen und Ingenieure, eine starke Forschungslandschaft und kluge Köpfe in Wirtschaft und Wissenschaft. Doch die eigentliche Aufgabe besteht darin, diese Stärken mit einer neuen Haltung zu verbinden: mit Mut, mit Neugier und mit der Bereitschaft, Risiken als Teil des Fortschritts zu akzeptieren.
Die zentrale Frage lautet daher nicht, ob wir KI beherrschen. Sondern ob wir bereit sind, sie wirklich zu gestalten – mit Verantwortung, mit Tempo und mit einem offenen Blick nach vorn.
Thomas Hollmann wird beim nächsten KI Business Breakfast in Düsseldorf zu Gast sein. Dort wird er mit uns darüber sprechen, wie Deutschland den kulturellen Rückstand in der KI-Nutzung überwinden kann und warum die wahre Transformation im Kopf beginnt – nicht im Code.