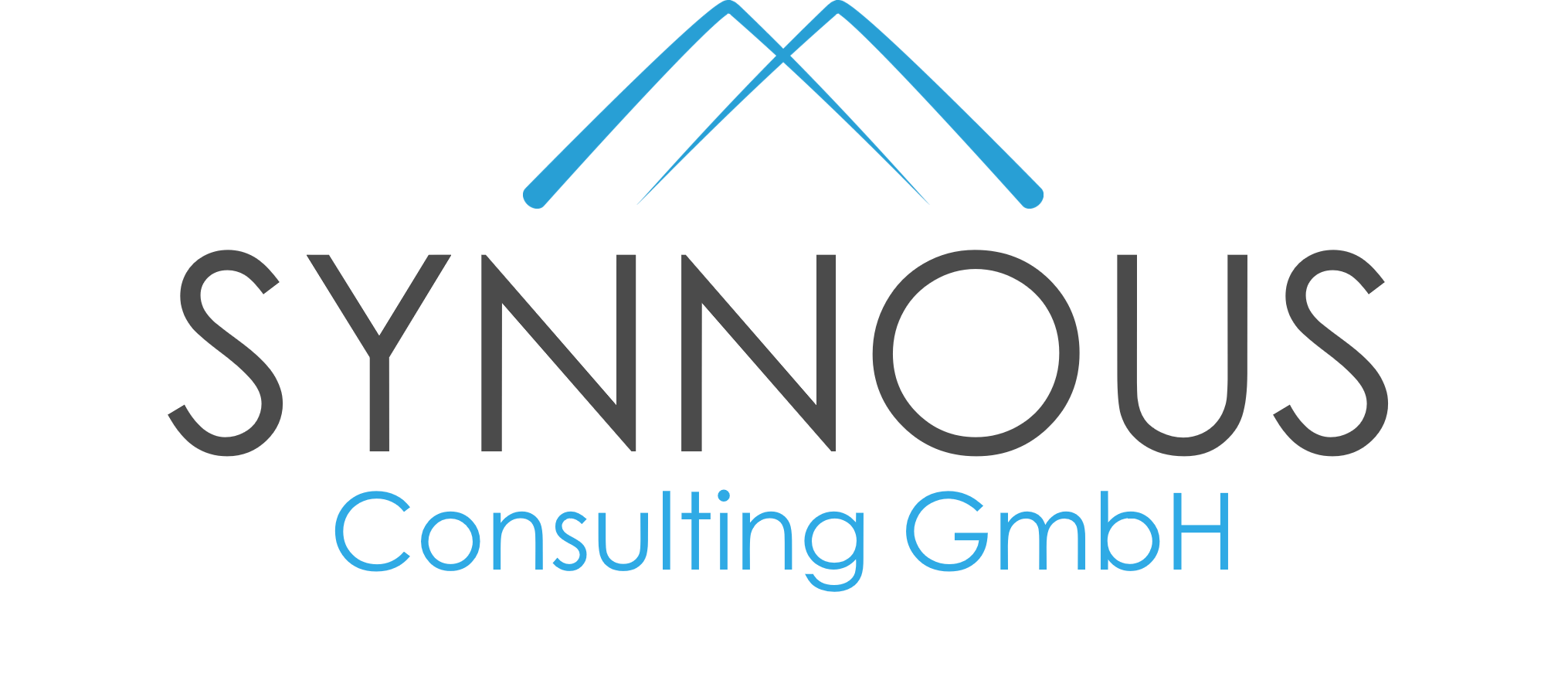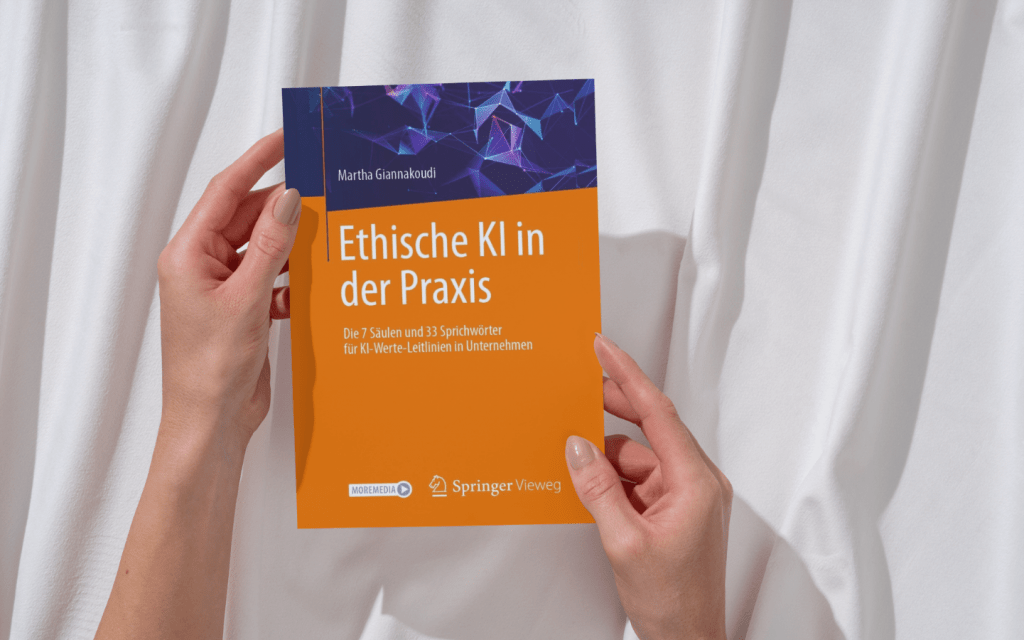Ein Studio-Termin, der vieles auf den Punkt brachte
Ein Anruf von n-tv, eine spontane Programmänderung – und plötzlich saß ich im Studio, um über ein Thema zu sprechen, das aktuell viele Menschen beschäftigt: Wird Künstliche Intelligenz unsere Jobs ersetzen?
Diese Frage taucht überall auf – in Redaktionen, Führungsetagen, Workshops. Sie wirkt einfach, ist aber in Wahrheit irreführend. Denn das, was uns wirklich herausfordert, ist nicht die Technologie selbst, sondern unser Umgang mit ihr. Im Gespräch mit Sybille Scharr habe ich fünf Beobachtungen geteilt, die zeigen, warum die größte Gefahr nicht von der KI ausgeht, sondern von unserer eigenen Haltung.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
1. KI ersetzt keine Jobs – sie verändert sie grundlegend
Die Vorstellung, dass KI einfach menschliche Arbeit ersetzt, greift zu kurz. In der Realität verändert sie bestehende Rollen – manchmal leise, manchmal radikal. Routinetätigkeiten, die sich wiederholen und vorhersehbar sind, werden automatisiert. Aber an ihre Stelle treten neue Aufgaben, die strategisches Denken, kreative Lösungsansätze und menschliche Kommunikation erfordern.
Für viele bedeutet das: Der eigene Job bleibt – aber er sieht anders aus. Wer den Fokus nur auf das richtet, was wegfällt, verpasst die Möglichkeit, sich aktiv auf das vorzubereiten, was neu entsteht. Es ist ein Perspektivwechsel, der Mut erfordert, aber auch große Chancen bietet.
Wenn du praxisnah lernen willst, wie genau dieser Wandel funktioniert, ist die KI Business School ein guter Ausgangspunkt.
2. Deutschlands wahres Problem ist nicht die Technologie, sondern kulturelle Trägheit
Technologisch sind wir gut ausgestattet. Viele Unternehmen verfügen längst über moderne Tools, Pilotprojekte und Zugang zu KI-Software. Doch was fehlt, ist nicht Technik – sondern eine Kultur, die diese Technologien wirklich zulässt und fördert.
Zögerlichkeit, übermäßiger Perfektionismus, Angst vor Fehlern: Das sind die eigentlichen Bremsklötze. Statt KI als Experimentierfeld zu begreifen, wird auf Sicherheit gesetzt – oft so lange, bis der Innovationszug längst abgefahren ist. Dabei ist klar: Die Tools sind da. Aber die kollektive Bereitschaft, sie auch einzusetzen, ist noch nicht flächendeckend angekommen.
„Die Frage ist nicht, ob KI kommt – sondern wie wir sie nutzen.“
Mehr zu unserer Arbeit mit Unternehmen, die sich dieser Herausforderung stellen, findest du im Blog.
3. Die Umsetzungslücke: Viele Unternehmen haben die Tools, aber keine Strategie
Diese kulturelle Zurückhaltung führt zu einem bekannten Problem: der Umsetzungslücke. In vielen Organisationen ist das Wissen über KI vorhanden. Die Tools sind lizenziert, die Pilotprojekte gestartet. Und trotzdem passiert – wenig bis nichts.
Warum? Weil es oft an klarer Strategie und internen Kompetenzen fehlt. Es gibt keine konkreten Ziele, keinen Plan für Integration, keine Verantwortlichen, die den Wandel treiben. Das Ergebnis: viel Potenzial bleibt ungenutzt. Man hat die Technologie, aber keine Vorstellung davon, was man damit eigentlich erreichen will. Diese „Knowing-Doing-Gap“ kostet Zeit, Geld und Innovationskraft.
4. Zukunftsfähige Führung beginnt mit Haltung – nicht mit Software
Wer KI im Unternehmen sinnvoll einsetzen will, muss verstehen: Der Wandel beginnt nicht bei der Technologie, sondern bei der Führung. Und Führung bedeutet in diesem Kontext nicht nur Entscheidungen zu treffen, sondern Orientierung zu geben – vor allem in unsicheren Phasen.
Dazu gehören drei Dinge: Erstens eine klare Haltung gegenüber technologischen Veränderungen. Zweitens die Bereitschaft, selbst zu lernen, auch jenseits des eigenen Fachgebiets. Und drittens die Fähigkeit zur kommunikativen Übersetzung – also komplexe Entwicklungen so zu erklären, dass andere mitgehen können. Führung, die KI erfolgreich einführt, braucht keine IT-Expertise. Aber sie braucht den Willen, den Wandel mitzugestalten.
Führungskräfte müssen KI nicht im Detail verstehen – aber sie müssen verstehen, was sie verändert.“
5. Menschliche Fähigkeiten werden in der KI-Welt nicht weniger wert – sondern entscheidend
Ein oft übersehener Aspekt in der KI-Debatte: Je mehr Maschinen übernehmen, desto wichtiger wird das, was Maschinen nicht können. Empathie. Urteilsvermögen. Verantwortung. Genau diese Fähigkeiten – oft als „Soft Skills“ bezeichnet – sind in Wahrheit die härtesten Währungen der Zukunft.
Denn KI kann Prozesse beschleunigen, Daten analysieren, Muster erkennen. Aber sie kann keine Haltung entwickeln. Kein Team führen. Keine Ambivalenz aushalten. Wenn wir also in Menschen investieren, investieren wir in das, was unsere Arbeitswelt wirklich zukunftsfähig macht.
Fazit: Die größte Gefahr ist nicht KI – sondern Untätigkeit
Die Debatte um KI wird oft technischer geführt, als sie sein müsste. Denn der eigentliche Hebel liegt nicht in Programmiersprachen oder Modellgrößen – sondern in der Frage, ob wir bereit sind, umzudenken. Wer KI ignoriert, läuft Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Wer sie klug einsetzt, kann Teams entlasten, Innovation ermöglichen und Freiraum für echte, menschliche Arbeit schaffen.
Die Zukunft der Arbeit ist kein Mensch-gegen-Maschine-Szenario. Sie ist ein Zusammenspiel. Und je früher wir anfangen, KI als Werkzeug zu begreifen, und nicht als Gegner, desto eher werden wir ihren echten Wert erkennen.
Was ist der eine Schritt, den Du oder Dein Unternehmen heute gehen könntet, um vom Zögern ins Handeln zu kommen?
Das vollständige Interview wurde bei n-tv ausgestrahlt.
Im Gespräch mit Sybille Scharr ging es um die Chancen und Herausforderungen von KI in der Arbeitswelt – und darum, was Unternehmen jetzt tun können.